In der Schweiz gibt es eine aktive und vielfältige Musikszene. Dennoch bleibt der Alltag für viele Musikschaffende geprägt von Förderanträgen, Nebenjobs und finanzieller Unsicherheit. Erfolg hängt längst nicht nur vom künstlerischen Können ab, sondern genauso von Strukturen und einem langen Atem. LMNOP mit einem Erklärungsansatz.
Lesezeit: ungefähr sieben Minuten
Auch in einem eher kleinen Land wie der Schweiz ist die Musikszene bunt, laut und vielfältig. Sei es Klassik, Jazz, Elektro, Pop, Rock oder eines der unzähligen Subgenres: Zu all diesen Stilrichtungen existieren eigene Szenen in allen vier Sprachregionen. Jede mit ihren Clubs und Festivals. Doch je grösser das Musikangebot, desto härter wird der Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit. Der Musikmarkt ist übersättigt und durch Plattformen wie Garageband und Soundcloud können alle selbst Musik machen und veröffentlichen. Einige Schweizer Acts erscheinen in Spotify-Playlists, im Radio und füllen sogar kleine Bühnen. Aber nur wenige schaffen es, mit Streams, Konzerten und Merch genügend Einkommen zu erzielen, um davon leben zu können. Ein Grossteil der Schweizer Musiker:innen ist deswegen auf einen weiteren Job angewiesen, der die Existenz sichert. So wird häufig die Musik zum Nebenjob, auch wenn es doch andersrum sein sollte.
Förderstrukturen am Beispiel von Pro Helvetia
Die Schweiz hat ein dichtes Netz an Fördermöglichkeiten für Musikschaffende. Dieses erstreckt sich von den Kantonen bis zum Bund, ergänzt durch zahlreiche private Stiftungen. Ein Beispiel für eine Förderung auf Bundesebene ist Pro Helvetia. Marius Kaeser, Fachspezialist Musik bei Pro Helvetia beschreibt ihre Förderstrategie so: Die rund fünf Millionen Franken Musikbudget von ihnen als unabhängige Stiftung des Bundes fliessen zu einem Grossteil in die internationale Verbreitung und Promotion von Schweizer Musik. Die Stiftung agiert nach dem «Giesskannenprinzip». Sie will die Musikszene so breit wie möglich abdecken. Pro Helvetia fördert vor allem die Entstehung neuer Werke, Tourneen im Ausland, den Austausch zwischen Sprachregionen und Auftritte an sogenannten Showcase Festivals, also Branchenevents, an denen Bands vor Publikum und internationalen Professionals gleichzeitig spielen.

Giesskanne oder Pipette? Förderstrategien im Vergleich
Eine andere Strategie verfolgt das Greenfield Festival und die dazugehörige «Greenfield Foundation». Diese arbeitet bewusst ohne staatliche Gelder und Gönner, um unabhängig zu bleiben. Die Festivalbesucher:innen finanzieren dabei die Stiftung mit ihren Spenden. Entweder weil sie aus unterschiedlichen Gründen Gratistickets erhalten haben oder weil sie bewusst auf die Rückerstattung des Geschirrdepots verzichten. Die Foundation konzentriert sich vor allem auf Rock-, Punk- und Metalbands und bietet ihnen zum Beispiel einen Bandcontest, verbunden mit einem Auftritt am Festival für die Siegerbands. Daneben gibt es den Rockfonds, der mit 30‘000 Franken jährlich dotiert ist und einzelne Bands sehr selektiv unterstützt. Während Pro Helvetia möglichst viele Szenen und Stilrichtungen abdecken will, setzt die Greenfield Foundation auf wenige Projekte mit grossem Potenzial. «Wir arbeiten nicht nach dem Giesskannenprinzip, sondern unterstützen gezielt wenige Bands, bei denen wir das Potenzial sehen, das Festival wirklich mitzutragen», sagt Frank Schwegler, Stiftungsratmitglied der Greenfield Foundation. Zusätzlich zu Pro Helvetia und solchen unabhängigen Stiftungen existieren in jedem Kanton und in vielen Städten eigene Programme, die näher an der lokalen Szene wirken. Dies umfasst etwa Beiträge für Albumproduktionen, Tourneen oder Clubprogramme, welche sie über ihre Kulturabteilung oder spezialisierte Musikbüros vergeben.
Vom Dossier zum Fördergeld
Wer Geld für ein Musikprojekt beantragt, trifft mit seinem Dossier meist zuerst auf eine Fachjury, die über Qualität, Konzept und Umsetzbarkeit entscheidet. Förderstellen und Kantone arbeiten oft mit Expert:innengremien oder Fachkommissionen, welche die eingereichten Projekte prüfen und beurteilen. Bei Pro Helvetia existieren für die Produktions- und Kreationsformate fest gewählte, aber zirka alle vier Jahre wechselnde Jurys. Diese Jurys beraten dort über einzelne Gesuche und lassen ihre Entscheide durch die Abteilungsleitung bestätigen. Sie bestehen nur aus wenigen Fachpersonen, welche meist über langjährige Praxiserfahrung in unterschiedlichen Musikfeldern verfügen. Ein zentraler Mechanismus im Schweizer Fördersystem ist das Subsidiaritätsprinzip. Fördergelder vom Kanton oder Bund verstehen sich als Ergänzung, nicht als einzige Finanzquelle. Das heisst konkret: Projekte sollten mehrere Geldgeber vorweisen – Gemeinde, Kanton, private Stiftung oder Eigenmittel – bevor sie Aussicht auf Unterstützung haben. Es ist ein gutes Zeichen für eine Stiftung, dass andere im Projekt auch Potenzial sehen. Viele kantonale Merkblätter nennen das ausdrücklich als Voraussetzung, und auch Pro Helvetia erwartet, dass Antragstellende ihre Finanzierung möglichst breit aufstellen.
Der erste Eindruck ist der wichtigste
Das Auswahlverfahren ist gleichzeitig ein Effizienz- und Glaubwürdigkeitsdilemma, denn Jurys bearbeiten viele Dossiers. Dies führt dazu, dass die Verantwortlichen für die Entscheide oft schnell einen ersten Eindruck gewinnen müssen. Bei der Greenfield Foundation fällt die erste Einschätzung oft sehr direkt aus: «Ich höre mir manchmal nur zehn Sekunden an. Entweder packt es mich sofort oder gar nicht», sagt Frank Schwegler. Bei Pro Helvetia betont man, dass für die Jury-Mitglieder künstlerischer Content, erkennbare Positionen und ein professionell aufgelistetes Projekt zählen. Wer also Erfolg bei den Förderungsinstitutionen will, muss nicht nur kreativ überzeugen, sondern sein Projekt so präsentieren, dass es auf den ersten Blick ankommt. Wer Fortschritte zwischen zwei Bewerbungen zeigen kann, erhöht seine Chancen deutlich.
Musik und Lebensunterhalt im Balanceakt
In der Schweiz schaffen es nur wenige Musikschaffende, ihren Lebensunterhalt vollständig mit Musik zu bestreiten. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Der Markt ist klein, das Publikum fragmentiert und die Konkurrenz je nach Genre hoch. Gerade Mundartmusiker:innen haben es meist schwer, ausserhalb des schweizerdeutschsprachigen Raums Fuss zu fassen, da sich die Zielgruppe sprachlich kaum ausweiten lässt. Viele wechseln zu Hochdeutsch oder Englisch, um international wahrgenommen zu werden und überhaupt Wachstumspotenzial zu haben. Für die meisten bleibt die Realität dieselbe: Die Einnahmen aus der musikalischen Tätigkeit reichen selten aus, um ein stabiles Einkommen zu gewährleisten. Deshalb arbeiten viele zusätzlich in Jobs, die mit ihrer künstlerischen Tätigkeit wenig oder gar nichts zu tun haben, etwa als Musiklehrperson oder in branchefremden Bereichen, wie zum Beispiel in der Gastronomie oder in einem Büro. Diese Doppelbelastung ist für viele zwar notwendig, hemmt aber wiederum den künstlerischen Fortschritt.
Kleine Gagen, grosse Kosten
Die finanzielle Unsicherheit der Musikschaffenden in diesem Land hat auch strukturelle Gründe. Wer den internationalen Durchbruch nicht schafft, bleibt in einem Markt hängen, der klein ist und in dem nicht einmal alle die gleiche Muttersprache haben. Viele Acts spielen vor einem kleinen Publikum, weshalb die Gage dementsprechend niedrig ausfällt. Konzerte decken oft nicht einmal die Anreise- oder Technikkosten, Veranstalter:innen stehen selbst unter Druck. Nicht weil sie «finanzielle Probleme» hätten, sondern weil sie den Bands und den Musiker:innen schlicht nicht mehr Gage zahlen können. Diese wiederum kämpfen mit steigenden Infrastruktur- und Personalkosten.
Ein weiterer Grund ist das Ausgehverhalten, welches sich seit der Pandemie verändert hat. Laut aktuellen Erhebungen gehen deutlich weniger Menschen an Konzerte oder in einen Club als vor Covid. Auch Streaming wirkt selten als Rettungsanker. Nicht einmal ein halber Rappen pro Stream waren schon früher kaum existenzsichernd. Heute werden Songs sogar erst vergütet, wenn sie über tausend Streams pro Jahr erzielen. Wer darunter bleibt, verdient nichts. Dadurch entsteht ein System, das grosse Acts belohnt und kleinere praktisch ignoriert.
Plan B ist Fluch und Segen zugleich
Die Summe dieser unberechenbaren Einnahmen machen es schwer, eine langfristige Sicherheit aufzubauen. Der Alltag vieler Musikschaffenden bleibt ein ständiges Jonglieren, zwischen künstlerischer Arbeit und wirtschaftlicher Absicherung.
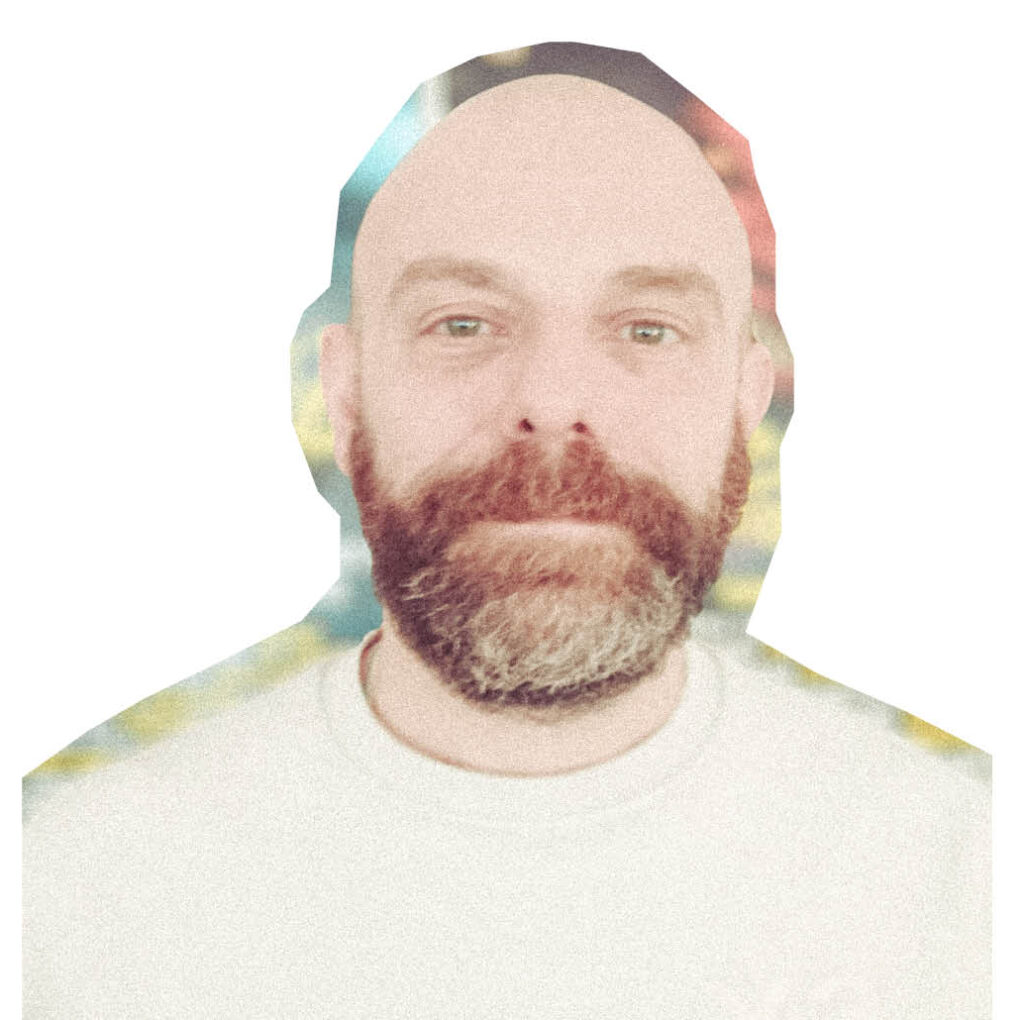
Frank Schwegler beobachtet zudem einen kulturellen Unterschied zu Ländern wie beispielsweise England: «Dort sind viele hungriger. Sie haben häufig keinen Plan B. In der Schweiz gibt es viele Möglichkeiten – und die meisten greifen darauf zurück.» In anderen Ländern ist Musik oft ein Ausweg aus der Armut. In der Schweiz wird sie seltener als einzige Lösung gesehen. Die gute Bildungsstruktur und die Vielzahl beruflicher Alternativen schaffen Sicherheit. Aber sie nehmen manchmal auch den Druck, alles auf eine Karte zu setzen. Musik bleibt für viele eher Leidenschaft als überlebenswichtige Perspektive.
Deshalb nun die Frage an dich: Hast du dir auch schon ernsthaft überlegt, eine deiner Passionen zum Beruf zu machen? Wo und wie unterstützt du die Schweizer Musikszene?

Schreibe einen Kommentar